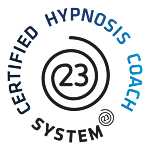Was ist Selbstsabotage – und warum betrifft sie so viele?
Du kennst das vielleicht: Du willst dich verändern, etwas Neues beginnen oder endlich den nächsten Karriereschritt wagen – und plötzlich ist da diese innere Bremse. Du zögerst. Du schiebst auf. Du findest Gründe, warum jetzt doch nicht der richtige Zeitpunkt ist.
Das ist kein Zufall. Das ist Selbstsabotage.
Und bevor du dich selbst dafür verurteilst: Selbstsabotage ist nicht irrational oder dumm – sie ist ein psychologisches Schutzprogramm.
Der stille Schutzmechanismus hinter dem Widerstand
Selbstsabotage schützt dich. Nicht vor Erfolg – sondern vor Schmerz.
Unser Gehirn liebt Sicherheit. Es ist darauf programmiert, Risiken zu vermeiden. Und je unsicherer ein neuer Schritt wirkt, desto lauter wird die innere Stimme, die dich davor warnt: „Was, wenn du scheiterst?“ – „Was, wenn dich niemand will?“ – „Was, wenn du enttäuscht wirst?“
Daraus entstehen typische Verhaltensmuster:
- Du beginnst Projekte, ziehst sie aber nicht durch.
- Du findest Ausreden, um wichtige Entscheidungen zu verschieben.
- Du sabotierst dich selbst mit Perfektionismus, Aufschieberitis oder ständiger Selbstkritik.
Fallbeispiel – Wenn die Bewerbung nie abgeschickt wird
Stell dir vor: Anna will raus aus ihrem Job. Sie hat sich eine vielversprechende Stelle ausgesucht, Lebenslauf aktualisiert, Motivationsschreiben formuliert.
Und dann? Nichts.
Die Bewerbung liegt fertig auf dem Desktop. Aber sie wird nie verschickt.
Anna erzählt sich: „Ich will noch einmal drüber schauen.“ Oder: „Der Zeitpunkt ist gerade schlecht.“ In Wirklichkeit sagt ihr System:
🛑 „Lieber das Bekannte aushalten als im Unbekannten scheitern.“
Dieses Muster ist kein Einzelfall. Viele Menschen bremsen sich genau in den Momenten aus, in denen sie vor einem echten Durchbruch stehen. Nicht, weil sie faul oder unentschlossen wären – sondern weil ihr innerer Schutzmechanismus Alarm schlägt.
Exkurs – Der häufigste Irrtum über Selbstsabotage
Viele glauben, Selbstsabotage sei ein Ausdruck von Schwäche, Faulheit oder fehlender Disziplin.
Das Gegenteil ist der Fall.
Selbstsabotage ist oft ein Zeichen von Sensibilität und Intelligenz. Dein System ist wachsam, es hat gelernt, auf vergangene Verletzungen oder Enttäuschungen zu reagieren – und schützt dich deshalb vor neuen Risiken.
Aber: Was dich früher geschützt hat, kann dich heute blockieren.
Selbstschutz vs. Selbstverwirklichung – Wie du den Unterschied erkennst
Der erste Schritt zur Veränderung ist immer das Verstehen.
Wenn du erkennst, dass dein Widerstand eine Funktion hat – nämlich dich zu schützen – kannst du aufhören, dich selbst zu verurteilen. Dann kannst du anfangen zu verstehen, was hinter deinem Verhalten steckt.
Typische Anzeichen, dass Selbstsabotage am Werk ist:
- Du willst etwas wirklich – aber du kommst nicht ins Handeln.
- Du redest dich selbst klein oder findest ständig Ausreden.
- Du hast Angst vor Ablehnung oder davor, Fehler zu machen.
Frage dich in solchen Momenten:
- Wovor genau will ich mich schützen?
- Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte?
- Welcher Glaubenssatz könnte hinter meiner Blockade stecken?
Selbstsabotage als Einladung zur inneren Arbeit
Selbstsabotage ist kein Endpunkt – sie ist der Anfang einer ehrlichen inneren Arbeit. Wenn du beginnst, dich nicht mehr für dein Zögern zu verurteilen, sondern dich fragst, wofür dieses Verhalten steht, entsteht ein neuer Handlungsspielraum.
Du musst nicht sofort alles verändern. Aber du kannst anfangen, neue Entscheidungen zu treffen – trotz deiner Angst. Trotz deiner Zweifel.
Das ist der Moment, in dem aus Selbstschutz echte Selbstwirksamkeit wird.
Fazit – Du bist nicht schuld. Aber du bist verantwortlich.
Selbstsabotage bedeutet nicht, dass du unfähig bist. Sie bedeutet nur, dass ein Teil von dir versucht, dich zu schützen.
Du kannst diesen Teil besser verstehen – und dich dennoch für Veränderung entscheiden. Verständnis ist der Anfang von echter Veränderung.
Wenn du bereit bist, hinzuschauen, eröffnen sich neue Wege. Nicht durch Druck, sondern durch innere Klarheit.